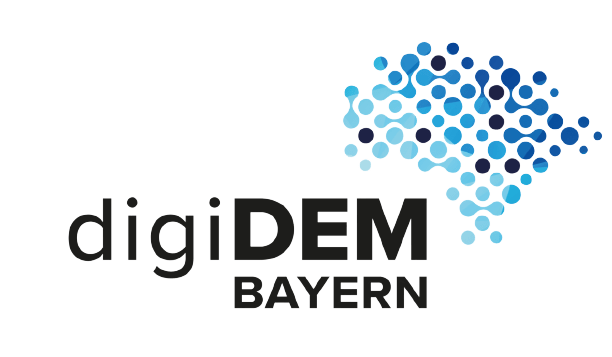In Deutschland leben zurzeit rund 1,7 Millionen Menschen mit Demenz. Etwa zwei Drittel von ihnen werden zuhause von Angehörigen versorgt, von Deutschlands „größtem Pflegedienst“. Doch diese werden durch die Belastung häufig selbst krank und zum „zweiten unsichtbaren Patienten“. Welche Faktoren spielen eine Rolle im Hinblick auf die Pflegebelastung? Wie entwickelt sie sich über 12 Monate? Diese Fragen wurden in einer aktuellen Studie auf Basis des Bayerischen Demenz Survey (BayDem) untersucht.
Die BayDem-Studie wurde an drei Regionen in Bayern durchgeführt: Dachau, Erlangen und Kronach stellen verschiedene demografische und sozioökoomische Gebiete dar. Für die aktuelle Untersuchung der Einflussfaktoren auf die Pflegebelastung von Angehörigen analysierten Nikolas Dietzel M.A. und Kolleg*innen von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg die Angaben von 295 Menschen mit Demenz und 276 pflegenden Angehörigen, die diese im Zeitraum von 2015-2017 zu verschiedenen Befragungszeitpunkten gemacht hatten.
Krankheitsbezogene Faktoren wie Verhaltensänderung haben wesentlichen Einfluss

Die Pflege wurde dabei zu mehr als zwei Dritteln von Frauen geleistet. Bei knapp der Hälfte der pflegenden Angehörigen handelte es sich um die oder den Ehepartner*in des Menschen mit Demenz. Die Pflegebelastung hing sowohl von krankheitsbezogenen als auch soziodemografischen Faktoren der Betroffenen und ihrer Angehörigen ab. Den wesentlichen Einfluss hatten dabei die krankheitsbezogenen Punkte – also eine Veränderung des Verhaltens der Menschen mit Demenz und eine Verschlechterung ihrer Alltagsfähigkeiten, etwa beim Anziehen, Waschen oder Essen. Frühere Studien, die ähnliche Ergebnisse erzielten, bieten verschiedene Erklärungen für die hohe Pflegebelastung, die Verhaltensveränderungen und schlechtere Alltagsfähigkeiten mit sich bringen: Sie können sich negativ auf die emotionale Bindung zwischen Menschen mit Demenz und ihren pflegenden Angehörigen auswirken, sind oft unvorhersehbar, störend und schwer zu bewältigen und können ein Gefühl von Scham und Erniedrigung hervorrufen. Zudem benötigt der pflegende Angehörige in der Regel schlicht mehr Zeit für die Versorgung, wenn die Alltagsfähigkeiten des Erkrankten schwinden – was in der Regel mit einer höheren Belastung einhergeht.
Höheres Belastungsempfinden durch traditionelle Rollenbilder?
Neben den krankheitsbezogenen Symptomen identifizierten Dietzel und Kolleg*innen auch zwei soziodemografische Faktoren, die die Pflegebelastung stark beeinflussten: das Geschlecht – sowohl der Menschen mit Demenz als auch der pflegenden Angehörigen – und die Stellung des Menschen mit Demenz zum pflegenden Angehörigen. So fühlten sich Frauen als pflegende Angehörige deutlich stärker belastet als Männer. Dies ist nach Ansicht der Autoren besonders hervorzuheben, da der größte Anteil der informellen Pflege von Frauen erbracht werde. Als mögliche Ursache für das höhere Belastungsempfinden bei Frauen nennen die Forscher traditionelle Rollenbilder. So wird die Versorgung von Angehörigen Studien zufolge eher von Frauen erwartet, was dazu führen könnte, dass Frauen diese Aufgabe auch aus Pflichtgefühl erledigen. In solch einem Fall sei die Belastung aber deutlich höher als wenn andere Motive wie etwa Zuneigung ausschlaggebend seien.
Ein weiteres Ergebnis: Pflegende Angehörige von Frauen mit Demenz waren stärker belastet als solche, die Männer pflegen – aber nur, wenn es sich auch bei den pflegenden Angehörigen um Frauen handelt. Frauen, die Frauen mit Demenz versorgten, stellen somit die Gruppe dar, die sich am stärksten belastet fühlte. Männer, die Frauen pflegten, empfanden dagegen die geringste Belastung. Auch die Stellung des pflegenden Angehörigen zum Menschen mit Demenz hat einen erheblichen Einfluss auf die empfundene Belastung: So fühlten sich Kinder von Betroffenen deutlich stärker belastet als Ehepartner. Eine Ursache könnte die Doppelbelastung sein, die durch die Erziehung eigener Kinder und die zusätzliche Pflege eines Elternteils entsteht.
Belastung stieg nicht kontinuierlich an
Ein überraschendes Ergebnis zeigte sich beim Verlauf der Pflegebelastung: So stieg die Belastung nicht kontinuierlich an – wie man es bei einer fortschreitenden Erkrankung wie der Demenz hätte erwarten können. Stattdessen fühlten sich die Angehörigen nach sechs Monaten weniger stark belastet als zu Beginn der Studie. Eine mögliche Ursache könnten – je nach Stadium der Demenz – erworbene Bewältigungsstrategien oder in Anspruch genommene Unterstützungsleistungen sein. Eine weitere mögliche Erklärung ist der sogenannte Hawthorne-Effekt: Danach könnte die Verbesserung allein durch das Bewusstsein der Probanden zustande gekommen sein, an einer Studie teilzunehmen. Nach zwölf Monaten allerdings stieg die empfundene Belastung wieder an.
Unterstützungsangebote für Menschen mit Demenz und Angehörige
Wie lässt sich die Belastung pflegender Angehöriger verringern? Nach Ansicht der Wissenschaftler können die identifizierten Einflussfaktoren hier eine Orientierung bieten. So könnten beispielsweise nicht-pharmakologische, psychosoziale Interventionen wie etwa die MAKS-Therapie die alltagspraktischen Fähigkeiten von Menschen mit Demenz – und somit die Situation der pflegenden Angehörigen – positiv beeinflussen. Bei MAKS handelt es sich um eine multimodale Intervention, die motorische, alltagspraktische, kognitive und sozial-kommunikative Übungen beinhaltet. In einer Studie konnte nachgewiesen werden, dass durch die MAKS-Therapie im Vergleich zur „üblichen Versorgung“ bessere Ergebnisse u.a. hinsichtlich der alltagspraktischen Fähigkeiten erzielt wurden. Zusätzlich zu solchen psychosozialen sowie pharmakologischen Behandlungen empfehlen die Autoren Maßnahmen, die die pflegenden Angehörigen einerseits in ihrer Rolle stärken, z.B. Schulungen, und andererseits den Versorgungsaufwand reduzieren, etwa die Inanspruchnahme von Betreuungsdiensten.
Um die Versorgung künftig besser an soziodemografische Gegebenheiten anzupassen ist nach Ansicht der Autoren eine tiefergehende Untersuchung der aktuellen Situation und Angebotsstruktur in Bayern notwendig. Eine solche Untersuchung ist inzwischen gestartet: Im Rahmen des „Digitalen Demenzregisters Bayern“, kurz „digiDEM Bayern“, werden Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen in ganz Bayern zum Krankheitsverlauf und zu ihrer Situation befragt, um die Versorgung langfristig zu verbessern. Zusätzlich werden digitale Angebote zur Unterstützung entwickelt. Gefördert wird das Projekt vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege. www.digidem-bayern.de
Die vollständige Studie finden Sie hier:
https://eref.thieme.de/ejournals/1439-4421_2020_01#/10.1055-a-1071-7886